Eltern Login
Kitas und Schulen in Stuttgart, Karlsruhe, München und vielen anderen Städten – jetzt Suche starten!

Die element-i Oberstufe (G9) in Karlsruhe startet
Es ist geschafft! Der Weg zur geplanten Oberstufe an der Freien element-i Gemeinschaftsschule im Bildungshaus Karlsruhe ist weitgehend frei. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat zwischenzeitlich eine

SchwimmMobil Wundine macht Halt in der Breitwiesenstraße
Laut einer Studie der Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich der Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern seit 2017 verdoppelt. Das sind alarmierende Zahlen! Die Josef Wund Stiftung

element-i Kinderhaus Wunderkiste offiziell eröffnet
Im Rahmen einer wunderschönen Eröffnungsfeier mit Getränken und Kuchen wurde im Beisein von Oberbürgermeister Klaus Heininger das element-i Kinderhaus Wunderkiste in Eislingen an der Fils
Stimmen zu element-i



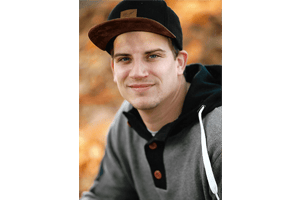


“Mein Kind kommt in die Kita!”: Eingewöhnung aus Sicht der Eltern
Die Eingewöhnung aus Elternperspektive und Bedeutung für die pädagogische Fachkraft Herbst-Zeit heißt in unseren Kinderhäusern Eingewöhnungszeit. Anfang November sind die ersten Eingewöhnungen hoffentlich erfolgreich beendet,

#wirsindelementi: unser Markenbotschafter Orkan Tan
Markenbotschafter:innen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Marken zum Leben zu erwecken und eine starke, loyale Gemeinschaft aufzubauen. Wir haben im Trägernetzwerk von KONZEPT-E überzeugte, engagierte

Praxisimpuls: Haustiere und Verantwortung
„Warum haben wir im Sterngucker eigentlich keine Haustiere?“ Eine Frage, die im Kinderhaus Sterngucker – und wahrscheinlich auch in anderen element-i Kinderhäusern – wohl schon

#wirsindelementi: unser Markenbotschafter Orkan Tan
Markenbotschafter:innen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Marken zum Leben zu erwecken und eine starke, loyale Gemeinschaft aufzubauen. Wir haben im Trägernetzwerk von KONZEPT-E überzeugte, engagierte

Mit dem Rad zum und um den Bodensee – Ausflüge der element-i Schule Karlsruhe
2 Räder – 3 Länder Klasse 7 und 8 radeln einmal um den Bodensee. Ein Bericht zum Projekt „Herausforderung“ von Lana und Valeska. Am Sonntag,

Werteerziehung: Wie Eltern demokratische Grundwerte vorleben
Toleranz, Verständnis, Respekt: Das sind demokratische Grundwerte, die Eltern ihren Kindern gerne vermitteln möchten. Theorieunterricht hilft dabei nicht. Vormachen funktioniert! Doch werden wir als Eltern